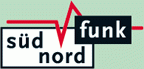südnordfunk #110
Gehen oder Bleiben? Klimaflucht, Klimakrise, Klimafinanzierung
Europa erlebte 2022 den heißestes Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Kontinent erhitzt sich schneller als jeder andere. Die jüngsten Hitzejahre waren keine Ausreißer, sie zeigen ein Muster an, als Ausdruck der Erderwärmung. Trotz Brandgefahr und hoher Risiken für Landwirtschaft und Gesundheit können sich die Menschen in Europa noch halbwegs von einem Hitzesommer in den nächsten retten - auch dank vorhandener, wenngleich unzureichender Sozialsysteme.
► Anders sieht es in Westafrika aus, zum Bespiel in Togo. Wie leben die Menschen hier mit dem Klimawandel? Eine Reportage gewährt Einblick.
► Umso wichtiger ist ein globales Finanzsystem, das für die Länder im Globalen Süden Entlastung bringt und Mittel freisetzt, wenn die Klimakrise in Form humanitärer Katastrophen zuschlägt. Der Gipfel Ende Juni für einen neuen globalen Finanzpakt formulierte Ideen, ist jedoch leider kein Durchbruch.
► Er bleibt umstritten, politisch wie rechtlich: Der Begriff der Klimaflucht. Die vorläufige Einigung der EU über das gemeinsame Asylsystem macht zusätzlich Druck auf alle, die vor der Klimakrise fliehen. Wenn der Klimawandel zum Aufbruch führt oder zur Flucht, sehen die Chancen auf ein Ankommen an einem sicheren Ort schlecht. Wir fragen nach den rechtlichen und politischen Dimensionen der Klimaflucht.
(Quelle: https://rdl.de/beitrag/s-dnordfunk-110-gehen-oder-bleiben-klimaflucht-kl...)